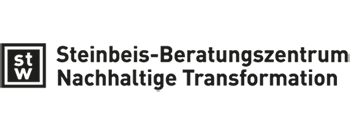Problemstellung:
Unternehmen fällt aufgrund des Umsatzes (>50 Mio. Euro) und Belegschaftsgröße (> 250) unter die Berichtsanforderungen der EU-Taxonomie. Die Quoten für Investitionen (CapEx), Betriebskosten (OpEx) sowie Umsatz sind der EU per Berichtsbogen zu übermitteln.
Herangehensweise:
- Interner Workshop zur Vermittlung der regulatorischen Hintergründe rund um die EU-Taxonomie
- Analyse der Wirtschaftsaktivitäten (Taxonomie-Fähigkeit)
- Abgleich der technischen Schwellenwerte (Technical Screening Criteria) für die als taxonomiefähig identifizierten Wirtschaftsaktivitäten und Klärung der Datenanforderungen für die Ableitung der „Taxonomie-Konformität“.
- Überprüfen der DNSH-Kriterien („do no significant harm“) zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die anderen EU Umweltziele
- Unterstützung bei der Datensammlung und -analyse sowie im Austausch mit dem Wirtschaftsprüfer
Ergebnis:
- Methodisch saubere Herleitung der zu berichtenden Taxonomie-Quoten
- Unterstützung im Austausch mit dem Wirtschaftsprüfer sowie beim Befüllen und Übermitteln des EU-Meldetemplates